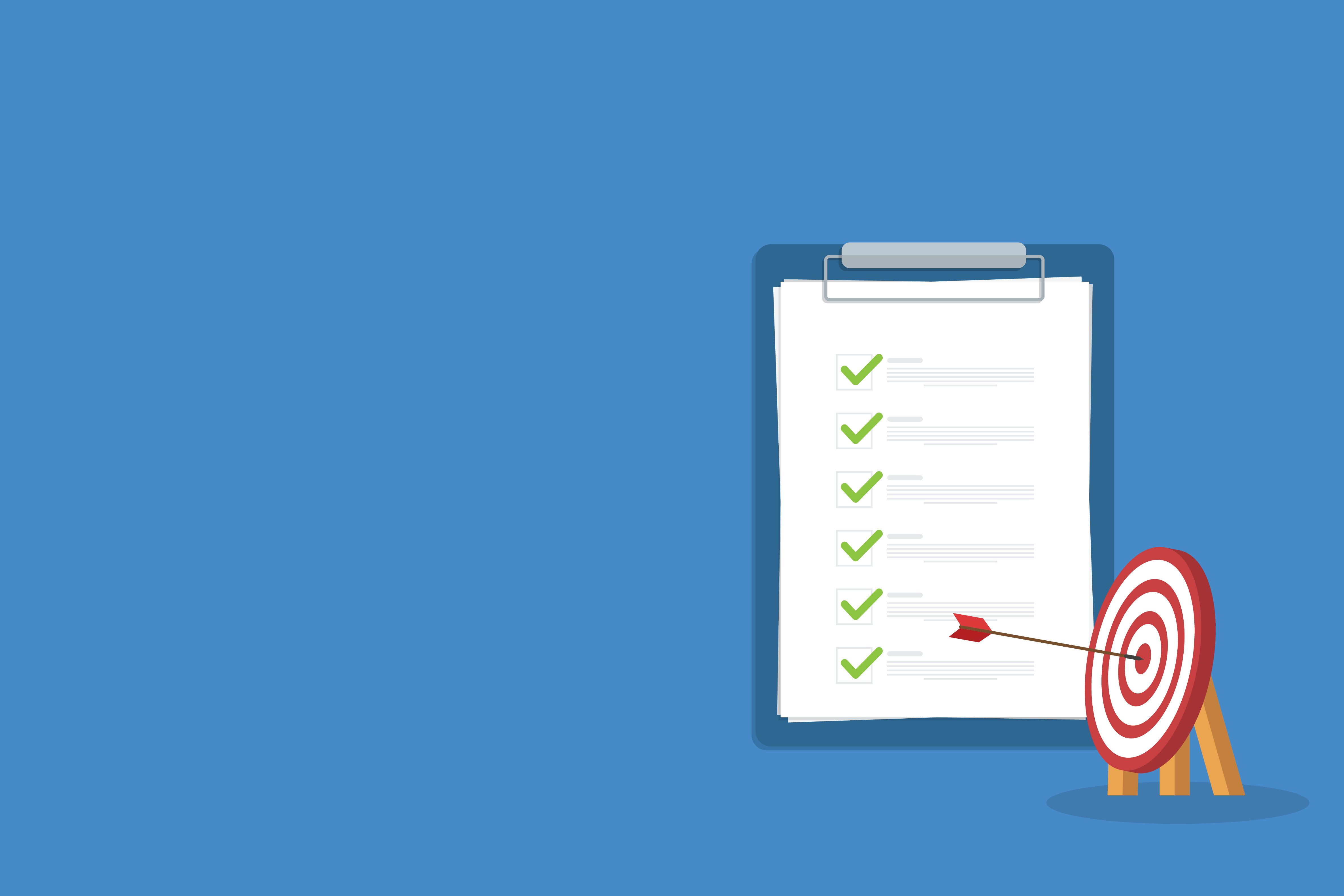Der vorliegende Entwurf des Berufsbildungsberichts 2025 wurde im Mai veröffentlicht und befindet sich aktuell noch in der Abstimmung mit dem Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). In seiner finalen Fassung wird er durch den Datenreport des BIBB ergänzt, welcher zusätzliche Analysen und vertiefende Informationen rund um die Entwicklung der beruflichen Bildung bereitstellt.
Hintergrund
Der Berufsbildungsbericht, der jährlich vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) veröffentlicht wird, bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklungen und Herausforderungen auf dem deutschen Ausbildungsmarkt. Er analysiert zentrale Kennzahlen wie das Angebot und die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen, beleuchtet strukturelle Trends sowie regionale Unterschiede und gibt einen Ausblick auf kommende Entwicklungen. Darüber hinaus beinhaltet er einen umfassenden Überblick über die berufsbildungspolitischen Aktivitäten und Programme der Bundesregierung. Damit bildet er eine wichtige Grundlage für politische Entscheidungen in der Berufsbildung und liefert Impulse für Akteure aus Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft.
Der Berufsbildungsbericht 2025 auf einen Blick
Im Vergleich zum Vorjahr kam es im Jahr 2024 zu
-
einem Rückgang der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge: Während die Zahl betrieblicher Verträge nur leicht zurückging (-0,3 %), fiel die Zahl außerbetrieblicher Verträge deutlich um 7,1 %. Die zuvor positiven Entwicklungen im Nachgang der Covid 19-Pandemie konnten somit nicht fortgeführt werden.
-
einem gesunkenen Angebot und einer gestiegenen Nachfrage nach Ausbildungsplätzen: Das seit 2021 kontinuierlich gestiegene Ausbildungsangebot ging im vergangenen Jahr um 1,2 % auf 556.100 Stellen zurück. Die Nachfrage junger Menschen nach einer dualen Berufsausbildung stieg hingegen leicht auf 517.900 an (+0,4 %).
-
anhaltenden Passungsproblemen beim Zusammenführen von Angebot und Nachfrage: Mit 31.200 Personen lag die Zahl unversorgter Bewerber*innen auf einem neuen Höchststand seit 2009. Hinzu kommen Bewerber*innen, die zwar eine Alternative zur Berufsausbildung begonnen haben (z.B. berufsvorbereitende Maßnahme, Praktikum etc.), jedoch weiterhin eine Ausbildungsstelle suchen – diese sind um 5,1 % auf 39.200 gestiegen. Dem gegenüber steht eine Zahl von 69.400 unbesetzten Ausbildungsstellen.
Größte Herausforderung: Passungsprobleme auf dem Ausbildungsmarkt beseitigen
Die Zahlen machen deutlich: Das Zusammenführen von Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt bleibt weiterhin die zentrale berufsbildungspolitische Herausforderung. Auf der einen Seite habe Betriebe Schwierigkeiten bei der Besetzung von Ausbildungsstellen (Besetzungsprobleme), auf der anderen Seite fällt es jungen Menschen zunehmend schwerer, ihrem Wunsch nach einer Berufsausbildung nachzukommen (Versorgungsprobleme). Tiefergehende Analysen zeigen deutliche Unterschiede bei der erfolgreichen Zusammenführung von Betrieben und Bewerber*innen, insbesondere in Bezug auf die
-
Betriebsgröße: Während fast alle Großbetriebe zumindest eine angebotene Ausbildungsstelle besetzen konnten, ist dies bei nur etwa jedem dritten Kleinbetrieb der Fall.
-
Regionen: Bewerber*innen aus Berlin hatten die größten Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu finden (gefolgt von Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bremen, Niedersachsen, Sachsen und Brandenburg). Am einfachsten fiel die Ausbildungsplatzsuche dagegen Bewerber*innen aus Thüringen und Bayern (gefolgt von Hamburg, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern).
-
Berufe: Während z.B. im Bereich Lebensmittelherstellung und –verkauf sowie im Hoch- und Tiefbau ein deutlicher Überhang an Ausbildungsstellen vorliegt, gab es im Friseurhandwerk, in der Softwareentwicklung oder der Tischlerei deutlich mehr Bewerber*innen als Ausbildungsstellen.
Neben diesen strukturellen Faktoren erschweren auch unterschiedliche Kommunikations- und Informationskanäle von Betrieben und jungen Menschen die Besetzung von Ausbildungsplätzen. Vor allem im Bereich Social Media weichen Rekrutierungswege oft vom tatsächlichen Suchverhalten der Jugendlichen ab.
Der Anteil junger Erwachsener ohne Berufsabschluss weiterhin auf hohem Niveau
Die absolute Anzahl Erwachsener zwischen 20 und 34 Jahren ohne formalen Berufsabschluss (d.h. ohne abgeschlossene duale oder schulische Berufsausbildung, Fachhochschul- oder Hochschulstudium) stieg in den vergangenen Jahren kontinuierlich an. Im Jahr 2023 lag sie bei 2,86 Millionen nicht formal qualifizierten jungen Erwachsenen (genauso hoch wie im Jahr 2022).
Die Quote der 20- bis 34-Jährigen ohne formalen Berufsabschluss lag im Jahr 2023 bei 19,0 % (2022: 19,1 %) – damit verfügt knapp jeder fünfte junge Erwachsene über keine abgeschlossene Berufsausbildung. Deutliche Unterschiede sind dabei in Bezug auf den Schulabschluss zu beobachten: Während die Quote bei Personen mit Studienzugangsberechtigung bei lediglich 7,9 % lag, besaßen mehr als drei Viertel (77,5 %) der jungen Menschen ohne Schulabschluss auch keinen Berufsabschluss. Diese Beobachtung wird durch aktuelle Ergebnisse aus der Jugendbefragung „Ausbildungsperspektiven 2025“ der Bertelsmann Stiftung noch einmal verschärft. Laut Studie gibt jede*r vierte Schüler*in mit niedrigem Schulbildungsniveau an, nach der Schule zunächst ohne formale Qualifikation arbeiten zu wollen. Auch wenn damit ein kurzfristig höherer Verdienst erzielt werden könne, riskieren sie damit, mittel- bis langfristig in Helfertätigkeiten zu verbleiben und dem Arbeitsmarkt damit nicht als dringend benötigte Fachkräfte zur Verfügung zu stehen. Zentral sei daher eine passgenaue Unterstützung am Übergang in die Ausbildung, zum Beispiel durch individuelle Beratung und Begleitung im Bewerbungsprozess.